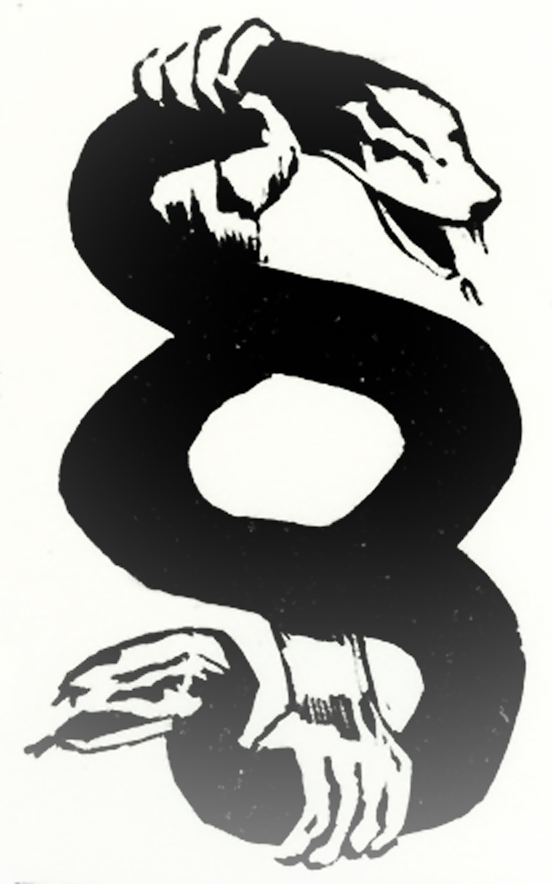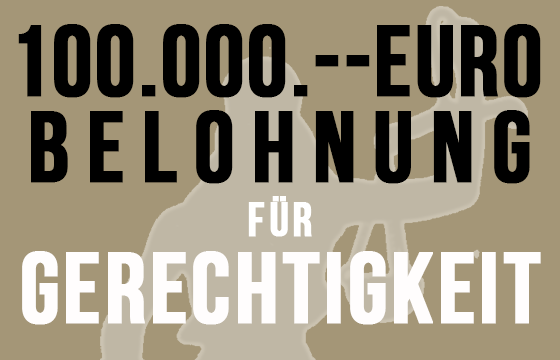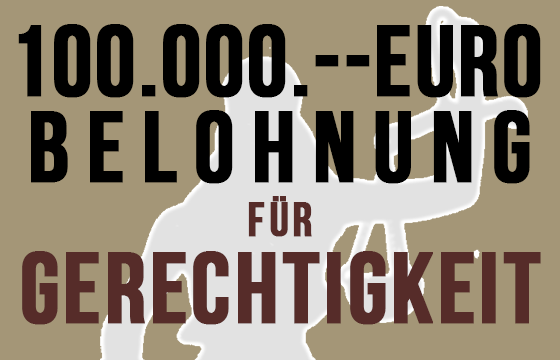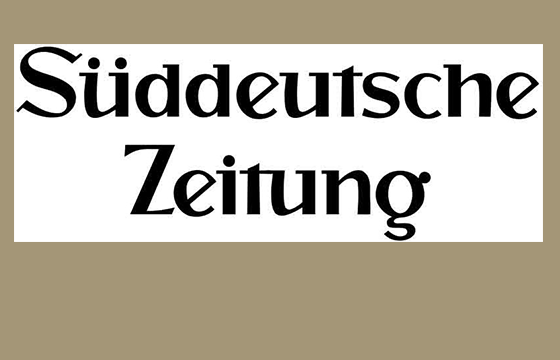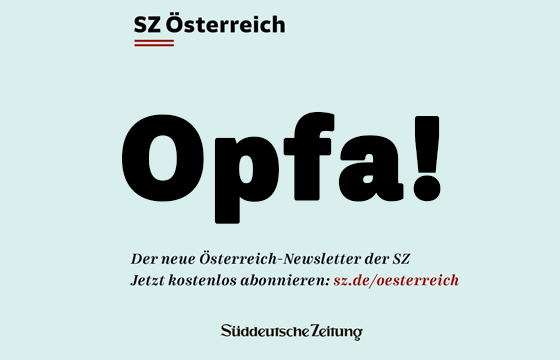Mängel in psychologischen Gerichtsgutachten erkennen und richtig bekämpfen

Mängel in psychologischen Gerichtsgutachten erkennen und richtig bekämpfen
Mängel in Gutachten im Familienrecht:
Jeder hat irgendwie Angst davor. Zwar weiss man ungefähr, dass diese alle nichts taugen, oder zumindest oft nicht. Und gleichzeitig weiss man auch, dass das Familiengericht zumeist nicht entscheidet ohne ein psychologisches Gutachten z.B. zur Erziehungsfähigkeit einzuholen. Meist ist das, was im Gutachten steht, auch schon das “Urteil”.
Sich richtig zu wehren, Fehler und Probleme zu erkennen, soll Aufgabe dieses Internet-Forums und Wissensdatenbank sein.
Die Österreichische Justizopfer-Hilfe will mit diesem Service Hilfe zur Selbsthilfe, Argumentationsunterstützungen und Aufklärung ohne teure Expertisen ermöglichen.
Dieses Informationsportal kann jedoch keine kompetente Beratung und individuelle Gutachtensanalyse ersetzen.
Richter delegieren Verantwortung an Gutacher:
Wenn Eltern streiten, freut sich das Amt: Dieser einfache Satz gilt für Sorgerechtsverfahren und Begutachtungsprobleme gleichermaßen. Von diesem Fall ausgehend wird deutlich, warum ein Richter sich der Hilfe eines Gutachtens bedienen muss: Er muss entscheiden, wenn sich Eltern nicht einigen können, wo ein Kind leben soll, wo es dem Kind gut oder besser geht.
Und weil das Recht für dieses Problem eben keine Kriterien kennt, gleichzeitig der Richter aber versuchen sollte eine faire Entscheidung zu treffen, versucht er etwas zu objektivieren, das man nicht objektivieren kann: Er beauftragt ein Gutachten.
Der Fehler liegt also einerseits im Streit der Eltern miteinander, die sich besser einigen hätten sollen, als auch im Problem, dass es – außer in krassen Misshandlungsfällen – keine objektiv messbaren Fakten gibt.
Leider, und das ist der Fehler, ist auch die Frage der Erziehungsfähigkeit nicht wirklich messbar.
Die einzige Komponente, die die Psychologie ernsthaft bemessen kann, ist der Intelligenzquotient. Dieser ist das einzige messbare psychologische Faktum.
Statt sich also selbst ein Bild zu machen, Beweise zu erheben und auszuwerten, versucht der Richter die Verantwortung für diese weitreichende Entscheidung ohne wirkliche Entscheidungsgrundlage auf mehr oder weniger verantwortungsbewusste Psychologische “Sachverständige” abzuwälzen.
Damit ist die Büchse der Pandorra geöffnet. Das Gutachten soll dem Richter eine Entscheidung ermöglichen. Dieses Ziel kann aber wissenschaftlich kaum erreicht werden – und es spart dem Richter kaum Zeit oder Arbeit.
Der Beweisbeschluss – Oft schon der Anfang des bitteren Endes!
Das Gericht wird also, wenn es eine Entscheidung treffen muss, als Erstes einen Beweisbeschluss erlassen. Dieser Beweisbeschluss ist quasi die Vorgabe für das Gutachten und deshalb muss er entsprechend hinterfragt werden.
Leider schaffen es viele Richter nicht, richtige Beweisbeschlüsse zu verfassen – und viele Anwälte erkennen falsche Beweisbeschlüsse nicht.
Oft wird der Beweisbeschluss nur an den Mandanten gesendet, statt bereits jetzt die Weichen für ein ordentliches Verfahren zu stellen.
Ist es schon an der Zeit, ein Gutachten einzuholen?
In vielen Verfahren wird man sagen müssen: Nein.
Denn die Grundlagen des Gutachtens müssen erst durch das Gericht geklärt werden. Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass der Gutachter hier Beweise erhebt und ermittelt.
Es ist Aufgabe des Richters, diese Beweise zu erheben und zu bewerten – und dann ein Gutachten zu beauftragen.
Der Richter muss zuerst entscheiden, wer lügt und was die Wahrheit und die vom Sachverständigen anzunehmenden Anknüpfungstatsachen sind ! i
Teilweise kann es notwendig sein, parallel zu agieren, also Gutachten und Beweisaufnahme parallel zu führen.
Jedenfalls ist es nach geltender Rechtsprechung NICHT Aufgabe des Gutachters, hier an Stelle des Richters tätig zu werden.
Die richterliche Pflicht zur Amtsermittlung kann nicht durch Beauftragung des Sachverständigen erfüllt werden.
Denn, und das ist die vielleicht wichtigste Entscheidung , das Gericht hat zuerst die Anknüpfungstatsachen (Vernachlässigung, mangelnde Hygiene, schulische Defizite, allfälligen Missbrauch usw.) als Ansatzpunkte der Begutachtung zu klären.
Wenn das Gericht also noch keine begründete Feststellungen, zu den vom Sachverständigen anzunehmenden Anknüpfungstatsachen getroffen hat, dann ist dies der erste Punkt, gegen den ihr als potentielle Justiz-Opfer vorgehen solltet.
So manche unwillige Juristen werden euch sagen, ass man gegen Beweisbeschlüsse nicht vorgehen könne – was richtig und falsch zugleich ist.
Eine Gegenvorstellung ist die Antwort
Richtiges Mittel ist die sogenannte „Gegenvorstellung”.
Mit dieser Gegenvorstellung schreibt ihr dem Richter, was an seinem Beweisbeschluss falsch ist, z.B. dass eben die Anknüpfungstatsachen bisher nicht geklärt sind und zumindest parallel zur Begutachtung vom Gericht selbst geklärt werden müssen.
Wenn ein Gericht hierauf wiederum nicht reagiert oder nicht zureichend begründet, stellt sich die Frage einer Befangenheitsrüge gegen den Richter. Denn ein Richter, der das Recht bewusst falsch anwendet, ist befangen.
Doch Vorsicht: Sind die Kinder erst weg, spielt die Zeit gegen Euch, dann ist Befangenheit oft nur Zeitverlust. Hingegen: Sind die Kinder bei Euch und ihr wollt Zeit gewinnen, dann kann man auch solche Schritte bedenkenlos gehen, man muss keine Angst haben, dass die Kinder entfremdet werden.
Die Gegenvorstellung ist aber auch das richtige Mittel, wenn die Beweisfrage oder der Gutachter falsch gewählt sind.
Ein Anwalt oder Berater, der den Beweisbeschluss also nicht intensiv durchschaut und richtigstellt, hat keine Ahnung und bringt Euch nur noch mehr Probleme und Kosten.
Fehler im Beweisbeschluss
Was ist nun ein typischer Fehler im Beweisbeschluss?
Ein Klassiker ist es, wenn das Gericht bereits das Ergebnis im Beweisbeschluss vorwegnimmt. Dies kann z.B. erfolgen, indem man bestimmte Krankheiten als „wahr” unterstellt, wenn es auf diese ankommt und wenn diese bisher nur als vorhanden vermutet werden oder die Beweisfrage sich nur gegen einen von mehreren Personen richtet. Hier kann der Teufel oft im Detail stecken.
Die Formulierung „es ist ein Gutachten zum Beweis der Tatsache zu erheben, dass die Mutter Borderline hat” nimmt das Ergebnis vorweg, weil nicht gefragt wird “ob” sie diese Krankheit hat.
Die Formulierung „es ist ein Gutachten zu erheben zur Frage, ob die Mutter krankheitsbedingt in der Lage ist die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen” ist zwar offen, fokussiert aber die Beweisfrage auf eine Krankheit und ist damit ebenfalls unzulässig.
Die korrekte Beweisfrage kann daher allenfalls lauten, “ob die Mutter und/oder der Vater in der Lage sind, die Bedürfnisse des Kindes xy zu erkennen und zu erfüllen.”
Hier wird oft geschlampt, und auch wir würden nicht jedes Mal gegen eine ungenaue Beweisfrage vorgehen. Letztlich kommt es immer auf den konkreten Fall an.
Unproblematisch ist dabei – wie oben ausgeführt – wenn das Gericht dem Gutachter eine bestimmte Situation vorgibt, denn dies ist seine vornehmliche Aufgabe.
Wenn das Gericht also schreibt
“dabei ist dem Gutachten zugrunde zu legen, dass die Mutter das Kind am 01.01.2019 mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat” ist betreffend des Beweisbeschlusses unproblematisch.
Es kann allerdings zu einer Befangenheit des Richters führen, wenn hierüber zuvor keine Beweiserhebung und Feststelungen stattgefunden haben.
Noch schlimmer wäre es, wenn der Vorfall vom 01.01.2019 verallgemeinert wird, zum Beispiel “dabei ist dem Gutachten zugrunde zu legen, dass die Mutter das Kind regelmäßig schlägt”, ohne eine oder mehrere konkrete Handlungen, auch der Zielrichtung nach, zu benennen.
Es muss darauf geachtet werden, dass der Sachverständige nicht als Richter tätig sein muss.
Die Beweisfrage „welche Regelung der elterlichen Sorge dem Kind xy am Besten dient” ist falsch, weil das, was nach Gesetz möglich ist, eben dem Gericht zu entscheiden vorbehalten ist und ein Psychologe hier gerade nicht alle Möglichkeiten kennen muss.
Deshalb werden Musterformulierung wie nachstehend empfohlen:
„1. Welche Belastungen und welche Vorteile sind für das psychische, physische oder seelische Wohl des Kindes zu erwarten, wenn …
Fehler im Beweisbeschluss
Was ist nun ein typischer Fehler im Beweisbeschluss?
Ein Klassiker ist es, wenn das Gericht bereits das Ergebnis im Beweisbeschluss vorwegnimmt. Dies kann z.B. erfolgen, indem man bestimmte Krankheiten als „wahr” unterstellt, wenn es auf diese ankommt und wenn diese bisher nur als vorhanden vermutet werden oder die Beweisfrage sich nur gegen einen von mehreren Personen richtet. Hier kann der Teufel oft im Detail stecken.
Die Formulierung „es ist ein Gutachten zum Beweis der Tatsache zu erheben, dass die Mutter Borderline hat” nimmt das Ergebnis vorweg, weil nicht gefragt wird “ob” sie diese Krankheit hat.
Die Formulierung „es ist ein Gutachten zu erheben zur Frage, ob die Mutter krankheitsbedingt in der Lage ist die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen” ist zwar offen, fokussiert aber die Beweisfrage auf eine Krankheit und ist damit ebenfalls unzulässig.
Die korrekte Beweisfrage kann daher allenfalls lauten, “ob die Mutter und/oder der Vater in der Lage sind, die Bedürfnisse des Kindes xy zu erkennen und zu erfüllen.”
Hier wird oft geschlampt, und auch wir würden nicht jedes Mal gegen eine ungenaue Beweisfrage vorgehen. Letztlich kommt es immer auf den konkreten Fall an.
Unproblematisch ist dabei – wie oben ausgeführt – wenn das Gericht dem Gutachter eine bestimmte Situation vorgibt, denn dies ist seine vornehmliche Aufgabe.
Wenn das Gericht also schreibt
“dabei ist dem Gutachten zugrunde zu legen, dass die Mutter das Kind am 01.01.2019 mit der Hand ins Gesicht geschlagen hat” ist betreffend des Beweisbeschlusses unproblematisch.
Es kann allerdings zu einer Befangenheit des Richters führen, wenn hierüber zuvor keine Beweiserhebung und Feststelungen stattgefunden haben.
Noch schlimmer wäre es, wenn der Vorfall vom 01.01.2019 verallgemeinert wird, zum Beispiel “dabei ist dem Gutachten zugrunde zu legen, dass die Mutter das Kind regelmäßig schlägt”, ohne eine oder mehrere konkrete Handlungen, auch der Zielrichtung nach, zu benennen.
Es muss darauf geachtet werden, dass der Sachverständige nicht als Richter tätig sein muss.
Die Beweisfrage „welche Regelung der elterlichen Sorge dem Kind xy am Besten dient” ist falsch, weil das, was nach Gesetz möglich ist, eben dem Gericht zu entscheiden vorbehalten ist und ein Psychologe hier gerade nicht alle Möglichkeiten kennen muss.
Deshalb werden Musterformulierung wie nachstehend empfohlen:
„1. Welche Belastungen und welche Vorteile sind für das psychische, physische oder seelische Wohl des Kindes zu erwarten, wenn …
Alle Tests auch im Ergebnis?
Ein anderes, häufiges Problem ist es, dass Tests zwar durchgeführt werden, aber eben im Ergebnis nicht mehr auftauchen. Wenn ein Gutachter 10 Tests für notwendig erachtet, muss er alle zehn auch im Ergebnis berücksichtigt haben. Wenn er nur neun dort berücksichtigt, ist dies auffällig, das Gutachten gegebenenfalls unverwertbar, weil doch genau dieser Sachverständige sagte er braucht diesen Test.
Natürlich kann es auch Testabweichungen geben, die am Ende keine Rolle spielen. Aber hierzu muss der Sachverständige eben ausführen, er kann es nicht einfach so stehen lassen oder wegfallen lassen. Wenn ein Test andere Interpretationen zulässt als ein anderer, dann muss man hierauf eingehen. Man kann nicht nur einen Test in das Ergebnis einfliessen lassen.
Aktenanalyse – Exploration – Interaktion
Die Analyse der Verfahrensakte muss analytisch und wissenschaftlich erfolgen. Dabei muss also der Prozessstoff in Kategorien systematisch analysiert werden und nicht einfach so “frei Schnauze”.
Dasselbe gilt für die Exploration, die auf Basis eines systematischen Gesprächsleitfadens erfolgen muss und die Interaktionsbeobachtung nach einem Ratingskala System (jeweils Leitner aaO).
Viele Gutachter halten sich nicht an diese notwendigen Vorgaben.
Aber diese Interpretation sollte man lieber durch die Unterstützung eines Experten ausführen und nicht einfach so dem Gutachter hinwerfen. Denn Ausreden a la “intern habe ich so eine Skala verwendet” sind schnell daher erfunden.
Wissenschaftlich und prüffähig ist das Gutachten aber nur, wenn diese Kriterien aus dem Gutachten heraus einsehbar und einlesbar sind.
Interaktionsbeobachtung
Die Interaktionsbeobachtung muss nach wissenschaftlichen Kriterien ausgewertet werden.
Gleichwohl gilt hier eben auch das Beweisproblem:
Was wenn der Gutachter subjektiv sagt, man habe ein Bedürfnis eines Kindes verkannt? Oft wird auch von Seiten der Ämter eine unfaire Situation heraufbeschworen, wenn erstmals zur Begutachtung nach langer Zeit ein Treffen mit den Kindern stattfindet.
Dann wird das Ergebnis verfälscht.
Oder wenn der Umgang unter Überwachung von Polizei oder Security stattfindet, dann bekommt alleine deshalb ein Kind ja Angst und verhält sich unnormal.
Oft wird auch verboten Spiele mitzubringen oder Essen – und dann wird dem Elternteil vorgeworfen nicht ausreichend gespielt zu haben oder eben den Kindesbedarf nicht wahrzunehmen.
All dies sind Faktoren, die die Interaktion beeinflussen.
Videoaufnahmen sind hier das einzige objektive Beweismittel. Für ein faires Verfahren und ein faires Gutachten führt hier kein Weg vorbei.
Natürlich gilt hier auch das oben zum kulturellen Background gesagte: Nicht jeder kann – ohne bösen Willen – eine Situation richtig einschätzen.
Die drei Säulen familienpsychologischer Gutachten:
- Säule Exploration Kind
- Säule Exploration Eltern
- Säule Interaktionsbeobachtung
Wenn eine Säule wegfällt, wackelt das Gebäude, bei zweien stürzen die Decken ein und bei dreien bleibt nichts übrig.
Wenn die Eltern sich verweigern, sind zwei Säulen weg: Ein seriöses Gutachten ist dann nicht möglich.
Wenn sich auch noch das Kind verweigert und nicht mit dem Gutachter spricht, dann hat der Gutachter nichts und das Gericht auch nicht.
Das so verfasste Werk kann man ernstlich nicht Gutachten nennen.
Doch wer denkt, dass damit kein Schriftstück Euch bewertet, der irrt.
Denn wenn die Mitwirkung fehlt, kann das Gericht versuchen die notwendigen Erkenntnisse auf sonstigem Wege zu holen.
Was passiert wenn ich nicht am Gutachten teilnehmt – oder nicht ganz – erklären wir auch noch.